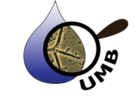Fachgebiet Umweltmikrobiologie
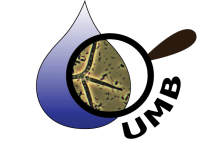
Zentrale Forschungsthemen des Fachgebietes umfassen die Untersuchung und Beschreibung der Komplexität und Diversität von natürlichen und in technischen Systemen genutzten Mischpopulationen von Mikroorganismen.
Besonderes Interesse finden dabei Biofilme, sowohl in der mikrobiellen Ökologie als auch der Biotechnologie.
Das Fachgebiet ist auch in der Lehre in verschiedenen Bereichen der Umweltmikrobiologie involviert. Wir bieten neben Veranstaltungen zum Schadstoffabbau und zur mikrobiellen Ökologie für den Studiengang Technischer Umweltschutz auch Serviceveranstaltungen für Studierende der Lebensmittelchemie, Chemie und Brauereitechnologie an.
Aktuelles
- Informationen zu unseren Lehrveranstaltungen im SS 2024
- Die Klausurtermine des Sommersemesters finden Sie hier
- Vorbesprechungstermine zu unseren Lehrveranstaltungen finden Sie hier
- Professor Szewzyk ist seit Anfang Oktober 2023 im Ruhestand
Standort
Kontakt
| Sekretariat | BH 6-1 |
|---|---|
| Gebäude | Bergbau Hütten Neubau |
| Adresse | Ernst-Reuter-Platz 1 10587 Berlin |